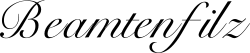Justiz auf Linie
Justiz auf Linie
Der Staat darf zur Bekämpfung der Corona-Pandemie inzwischen nahezu alles tun, was die Politikerfantasie fordert. Mit dem "Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" hat der Bundestag im November die Exekutive zu weitgehenden Grundrechtseingriffen ermächtigt. Von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen über die Einschränkung von Religionsausübung und Versammlungen bis hin zur Schließung von Einrichtungen aller Art kann die Freiheit der Bundesbürger in nie da gewesenem Maße beschnitten werden. Das Gesetz ist weniger eine Einhegung der Regierung durch das Parlament als vielmehr eine Einladung zu Rechtseingriffen.
© privat
Josef Franz Lindner
lehrt Staats- und Medizinrecht an der Universität Augsburg.
Eine umso wichtigere Kontrollfunktion kommt daher den Verfassungs- und Verwaltungsgerichten zu. Nur sie können eine Politik, die in der Pandemiebekämpfung hauptsächlich auf Repression setzt, noch in die rechtsstaatlichen Schranken weisen. Doch die Justiz enttäuscht zunehmend. Die flächendeckende, dauerhafte und bar jeglicher Differenzierung verfügte Schließung aller Kultur- und Sporteinrichtungen, von Schulen und Hochschulen, der Gastronomie und des Einzelhandels; selbst die einer Ausgangssperre gleichkommenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen – keinen dieser massiven Grundrechtseingriffe haben die Gerichte bislang kassiert. Eine einsame Ausnahme markierte vorvergangene Woche das Amtsgericht Weimar, das allerdings ins andere Extrem verfiel und seltsam holzhammerhaft gegen den Lockdown-Kurs der Bundesregierung austeilte, indem es ihn als Würdeverletzung tadelte.
Die Verwaltungsgerichte haben zwar auch in der ersten Phase der Pandemie die Corona-Politik der Länder nicht grundsätzlich infrage gestellt. Allerdings gab es doch etliche Entscheidungen, die der Exekutive Grenzen aufgezeigt haben: Versammlungen wurden zugelassen, Anreiseverbote zu Zweitwohnungen kassiert, Verkaufsflächenzahlen gekippt (die berühmte 800-Quadratmeter-Regel) oder der Lockdown im Kreis Gütersloh (nach einem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies) für rechtswidrig erklärt. Das ist mittlerweile anders. Zwar ergehen vereinzelt kritische Gerichtsentscheidungen. Diese betreffen aber eher Details (wie etwa das flächendeckende Alkoholverbot in der Öffentlichkeit oder die genaue Definition des 15-Kilometer-Radius in Bayern) und erweisen sich mitunter sogar als kontraproduktiv. So hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die vollständige Schließung von Fitnessstudios für gleichheitswidrig erklärt, weil Individualsport in Sporthallen noch erlaubt war. Folge: Nur wenige Stunden nach dieser Entscheidung hat Bayern dann auch den Individualsport in Sporthallen verboten – prompte Herstellung der Gleichheit durch Verbot für alle!
Woran liegt es, dass die Gerichte der Exekutive mittlerweile nahezu alles durchgehen lassen? Wenn man einmal außer Acht lässt, dass es sich bislang um Eilentscheidungen handelt, in denen die Gerichte lediglich eine summarische Prüfung durchführen, sind mindestens vier Erklärungsansätze denkbar:
Erstens, weil die Krise jetzt schlimmer ist als im Frühjahr 2020. Unabhängig davon, ob dem tatsächlich so ist, muss man entgegnen: Die Bevölkerung verfügt heute aber auch über mehr Kenntnisse, mehr Schutzmaterial (insbesondere FFP2-Masken), ausgearbeitete Hygienekonzepte oder Schnelltests. All dies lässt prinzipiell bezweifeln, ob manch rigide Maßnahmen im zweiten Jahr der Pandemie noch immer verhältnismäßig sind, wie Juristen sagen, sprich: ob sie nur so weit in Grundrechte eingreifen wie unbedingt nötig.
Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 05/2021. Hier können Sie die gesamte Ausgabe lesen.
Eine zweite Erklärung könnte lauten: weil sich die Gerichte von der zunehmend alarmistischen Rhetorik der Politik anstecken lassen. Das zu eruieren wäre ein lohnenswertes Forschungsprojekt insbesondere für die Rechtssoziologen und -psychologen: Wie verändert sich Rechtsprechung in einer Krise bei permanenter Dramatisierungsrhetorik, auch in Medien und sozialen Netzwerken? Erkenntnisse dazu wären auch längerfristig wertvoll, da die Annahme nicht fernliegt, dass die aktuell eingeübten Muster politischer Kommunikation und die Routinen der Freiheitseingriffe nahtlos auch für die Klimapolitik verwendet werden könnten. Schreckensszenarios sind beliebig auswechselbar.
Ein dritter Grund dürfte das aufgegangene Kalkül der Politik sein, sich durch das Versprechen von Entschädigungen ("Novemberhilfen") etwa für die Gastronomie die Verhältnismäßigkeit der Schließung zu erkaufen und gerichtsfest zu machen. Dass diese Hilfen zum Teil bis heute nicht geflossen sind, müssten die Gerichte zumindest in den Hauptsache-Entscheidungen thematisieren.
Entscheidend für die "Großzügigkeit" der Gerichte dürfte – viertens – sein, dass bei der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes mittlerweile eine bemerkenswerte, im Rahmen von Eilverfahren allerdings nicht untypische Oberflächlichkeit erkennbar wird. Jede Maßnahme, die auch nur ganz entfernt, nur theoretisch dazu beitragen kann, Kontakte (und damit potenzielle Virusübertragungen) zu vermeiden, wird von den Gerichten akzeptiert. Ein drastisches Beispiel ist die in Bayern geltende nächtliche Ausgangsbeschränkung, die das Verlassen der Wohnung nach 21 Uhr auch zum alleinigen Spaziergang oder Sport verbietet. Dieses Verbot ist nach Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs geeignet, das Ziel der Kontaktvermeidung zu erreichen.
Dem mag man gerade noch zustimmen – auch wenn die Annahme ziemlich weit hergeholt ist, dass es beim einsamen Joggen oder Spazierengehen nach 21 Uhr zu (risikobehafteten) Kontakten kommt. Es entspricht zwar nicht der Lebenserfahrung, dass sich joggende Menschen im Winter nachts heimlich im Wald zum Bier treffen, aber wer weiß, es könnte theoretisch ja mal vorkommen. Außer Betracht lässt das Gericht indes, dass der tatsächliche Beitrag des Verbots für die Kontaktreduzierung so gering ist, dass er in keinem Verhältnis zum Ausmaß des Grundrechtseingriffs steht: minimaler Effekt bei maximaler Freiheitsbeschränkung.
Maßnahmen wie diese sind erkennbar Ausdruck von aktionistischer Willkür und einer auf undifferenzierte Totalverbote setzenden Politik. Es ist erstaunlich, dass ein Oberverwaltungsgericht ihren bestenfalls marginalen Beitrag zur Seuchenbekämpfung nicht ins Verhältnis zur gravierenden Intensität der Freiheitsbeschränkung setzt. Stattdessen wird abstrakt Leben gegen Joggen abgewogen, wobei das Ergebnis dann klar ist.
Mit einer solchen von der Frage des konkreten Wirkgrades der Maßnahme völlig gelösten Abwägung kann man nahezu jede freiheitsbeschränkende Maßnahme rechtfertigen; verhältnismäßig wäre dann auch ein genereller Hausarrest mit Ausnahme lebenserhaltender Einkaufsgänge oder von Arztbesuchen. Urteilsbegründungen "voller Widersprüche und Oberflächlichkeiten" (so die Staatsrechtskollegin Andrea Kießling) führen zu nachgerade grotesken und unmenschlichen Ergebnissen: Die Krankenpflegerin darf zwar zur abendlichen Rushhour im überfüllten Regionalzug (bei maximalen Kontakten) nach Hause fahren, später aber nicht mehr ihre 80-jährige Mutter besuchen, selbst wenn diese bereits geimpft ist. Der um seine Existenz bangende schlaflose Gastwirt darf nicht zu einem Spaziergang vor die Tür, um wenigstens etwas zur Ruhe zu kommen und seinen Blutdruck zu bändigen. Man darf nachts noch mit dem Hund raus, aber nicht ohne Hund.
Die einseitige Rhetorik einiger Politiker, in Zeiten der Pandemie sei kein Raum für Differenzierung und Ausnahmen, scheint als Denkart ihren Weg in die Gerichtsbarkeit gefunden zu haben.
Doch der Rechtsstaat muss sich auch, ja gerade in der Krise bewähren – und dazu gehören Verhältnismäßigkeit und Differenzierung. Dies ist in Notzeiten schwierig und nicht vollständig erreichbar. Es verlangt der Politik Besonnenheit und Kreativität ab. Demgegenüber ist die pauschale Verordnung eines flächendeckenden Lockdowns der einfachere Weg. Bequemer auch als der gezielte Schutz vulnerabler Menschen, die sich nicht selbst schützen können. Die Politik in den dafür zuständigen Ländern hat beim Schutz dieser Menschen leider nicht denselben Ehrgeiz an den Tag gelegt wie bei der Verhängung immer härterer Freiheitseingriffe zulasten aller. Dies zeigen die hohen Todeszahlen bei den über 80-jährigen Menschen.
Diese eindimensionale Gleiche-Unfreiheit-für-alle-Strategie ist nicht nur ein politisches Problem, sondern müsste eigentlich auch die Gerichte interessieren. Denn der Staat kommt seiner verfassungsrechtlichen Schutzpflicht für die Schwächsten der Gesellschaft offensichtlich nicht hinreichend nach. Der Zusammenhang von unzureichendem Schutz und übermäßiger Repression ist evident: Je stärker die Politik Risikogruppen wirksamen Schutz vorenthält, desto voller sind Intensivstationen und Leichenhallen. Dies dient dann zur Rechtfertigung für noch schärfere Repression. Man muss die Frage rechtlich zuspitzen: Ist ein harter Lockdown nur deswegen notwendig, weil die Politik wirksame Schutzmaßnahmen an entscheidender Stelle unterlässt? Wäre er ansonsten nicht erforderlich, und ist er daher rechtswidrig? Dieser Kernfrage gehen die Gerichte bislang aus dem Weg.
Die Justiz ist, man muss es leider so sagen, mittlerweile auf Linie einer auf Repression fokussierten Exekutive. Die eigentliche Bewährungsprobe steht dem Rechtsstaat aber möglicherweise erst bevor: Wie weit darf Politik (noch) gehen? Totale Ausgangssperren auch tagsüber, Stilllegung von Betrieben oder des ÖPNV? Wo sind die roten Linien? Es ist sehr gut möglich, dass die Verfassungs- und Verwaltungsgerichte diese Frage noch werden beantworten müssen – auch deshalb, weil sie bisher kaum Grenzen gezogen haben.
Comments
No Comments